Innendämmung bei Altbau und Denkmalschutz: Rettung oder Risiko?
✅ „Innendämmung“ – Lösung für denkmalgeschützte Gebäude?
Die Innendämmung hat viele Gesichter und spielt gerade bei einer Unterkellerung sowie unter dem Dach eine große Rolle. Aber auch die Dämmung der Innenwände durch Dämmputz oder die Bodendämmung für mollig warme Füße sind Aspekte für die Innenraum-Dämmung. Dabei gilt es auch hier wieder einige Auflagen zu beachten, denn ein ausgebautes Wohndach muss hinsichtlich der Dämmung andere Anforderungen erfüllen, als ein einfacher Speicher unter dem Dach. Genauso ist es beim Keller.







Eine Innendämmung kann aber auch eine sehr bedeutende Angelegenheit bei Altbauten, die unter Denkmalschutz stehen, sein, denn hier ist eine Dämmung der Außenfassade in einigen Fällen durch rechtliche Auflagen nicht möglich. Wer die historische Fassade erhalten möchte, aber dennoch Heizkosten sparen und den Wohnkomfort steigern will, sollte ernsthaft über eine Innendämmung nachdenken. Bei Baudenkmälern bieten sich unter anderem Dampfsperren oder feuchtigkeitsresistente Platten an, auch Dämm- und Sanierputz können eine Alternative sein. E
Video Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=T_-AtyxNm60&t=106s
Doch wie funktioniert Innendämmung ohne Feuchteschäden? Welche Dämmstoffe sind zulässig? Und was sagt das Denkmalschutzgesetz? Hier kommt der komplette Überblick – inklusive Gesetzeslage, Förderungen, Materialliste und Tipps zur Verarbeitung.
🏛️ Rechtlicher Rahmen: Was sagt das Gesetz?
In Deutschland regelt das Denkmalschutzgesetz der Länder, ob und wie energetische Maßnahmen an geschützten Gebäuden zulässig sind. Die energetische Sanierung muss immer mit der zuständigen Denkmalbehörde abgestimmt werden (§ 7 EStG i. V. m. den Landesgesetzen). Wichtig: Maßnahmen im Inneren – wie eben die Innendämmung – sind häufig genehmigungsfrei, müssen aber trotzdem dokumentiert werden.
🔎 § 7i EStG: Wer denkmalgeschützte Immobilien saniert, kann steuerliche Vorteile erhalten – bis zu 9 % der Sanierungskosten in den ersten 8 Jahren, danach 7 % über 4 Jahre verteilt.
💶 Förderung: Diese Programme helfen beim Sparen
Mit einer Innendämmung schützen Sie Ihr Zuhause vor Kälte und Schimmel
Die Innendämmung ist eine effektive Maßnahme zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden, insbesondere wenn eine Außendämmung nicht möglich ist. Was genau man unter Innendämmung versteht, wann sie sinnvoll ist und welche Vor- und Nachteile sie bietet, lesen Sie hier. https://www.vr.de/privatkunden/themenwelten/wohnen-immobilien/sanieren-modernisieren/innendaemmung.html
Denkmalgerechte Innendämmung ist teuer – aber förderfähig:
| Förderprogramm | Beschreibung | Höhe der Förderung |
|---|---|---|
| KfW 261 (BEG) | Einzelmaßnahme Innendämmung | bis zu 20 % Zuschuss |
| BAFA-Zuschuss | Sanierungsfahrplan, energetische Beratung | bis zu 80 % der Beratungskosten |
| Landesförderung | In vielen Bundesländern zusätzliche Zuschüsse | unterschiedlich |
👉 Wichtig: Vor Baubeginn Förderantrag stellen! Ansonsten kann die Förderung verwahrt werden!
🏗️ Historischer Rückblick: Warum Innendämmung?
Bereits im 19. Jahrhundert wurde in Großstädten mit Innendämmungen experimentiert – meist zur Verbesserung des Schallschutzes. In den 1930ern waren Holzfaser– und Heraklithplatten weit verbreitet.
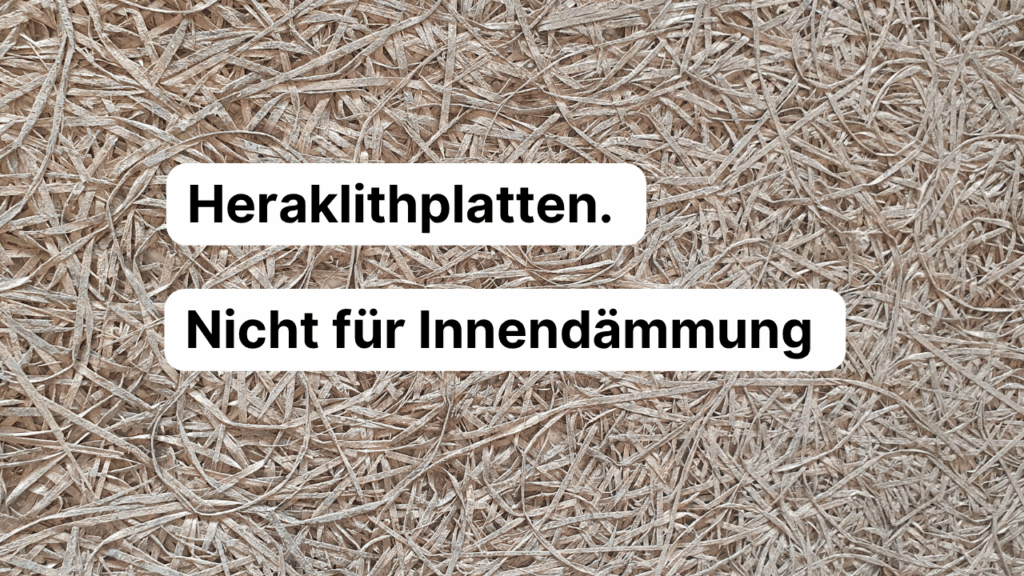
Doch in den 1950er-Jahren kam es vermehrt zu Feuchteschäden. Schuld daran war das vereinfachte Glaser-Verfahren, das Tauwasser falsch prognostizierte. Die Folge: Innendämmung geriet zu Unrecht in Verruf – bis heute.
🧱 Vorteile der Innendämmung im Altbau
✅ Erhalt der historischen Fassade
✅ Verbesserung des Wärmeschutzes von innen
✅ Oft genehmigungsfrei umsetzbar
✅ Heizkostenersparnis von bis zu 30 %
✅ Steuerliche Abschreibung möglich
🚧 Die Risiken – und wie man sie vermeidet
💧 Feuchtigkeit und Taupunkt
Der größte Feind der Innendämmung: kondensierende Feuchtigkeit an der Grenzschicht zwischen Dämmung und Außenwand. Die Folgen können sein:

- Schimmelbildung
- Frostschäden
- Strukturzerfall des Mauerwerks
Moderne Lösung: kapillaraktive Dämmstoffe wie Kalziumsilikat oder Lehmplatten, die Feuchte aufnehmen und wieder abgeben können.
🧰 Verarbeitung: So wird’s richtig gemacht!
Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Bestandsaufnahme: Mauerwerk auf Schäden und Durchfeuchtung prüfen
- Materialwahl: diffusionsoffene, kapillaraktive Materialien bevorzugen
- Untergrund vorbereiten: tragfähig, trocken, schimmel- und salzfrei
- Dämmplatten verkleben: vollflächig, fugenfrei
- Armierung: mit Gewebeeinlage gegen Rissbildung
- Endbeschichtung: diffusionsoffener Putz oder Lehmputz
👉 Achtung: Keine Dampfsperren verbauen! Diese blockieren die natürliche Feuchtewanderung.
🧱 Tabelle: Gängige Innendämmstoffe im Vergleich
| Dämmstoff | Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | Eigenschaften | Geeignet für Altbau? |
|---|---|---|---|
| Mineralwolle | 0,035 | günstig, nicht kapillaraktiv | bedingt |
| Holzfaserplatte | 0,045 | diffusionsoffen, ökologisch | ja |
| Kalziumsilikatplatte | 0,060 | hoch kapillaraktiv, schimmelhemmend | ideal |
| PU-Hartschaum | 0,025 | sehr dämmstark, dampfdicht | nein |
| Schilfrohrplatte | 0,070 | naturbelassen, diffusionsoffen | ja |
📊 Beachte!
Je kleiner der Wert λ, desto besser die Dämmwirkung. Achtung: Nicht nur der λ-Wert zählt – auch Feuchtepufferung und Diffusionsverhalten sind entscheidend!
🧑🔧 Innendämmung funktioniert – aber nur bei richtiger Planung!
Innendämmung ist kein Notnagel, sondern eine technisch anspruchsvolle und hochwirksame Lösung für den Wärmeschutz bei denkmalgeschützten Gebäuden. Entscheidend sind:
- Fachgerechte Planung
- Auswahl geeigneter Materialien
- Verzicht auf dampfdichte Schichten
- Genaue Ausführung aller Anschlüsse und Details
Wer alles richtig macht, kann sein historisches Gebäude nicht nur optisch, sondern auch energetisch auf den neuesten Stand bringen – und dabei noch Steuern sparen!

